In diesem Beitrag zeige ich, wie mein Wanderführer entsteht – von der ersten Recherche bis zur Druckfreigabe. Wie andere Autorinnen oder Autoren arbeiten, kann ganz anders aussehen. Für mich hat sich dies bewährt: Auch beim dritten Buch läuft es nach dem gleichen Prinzip. Jeder der Schritte enthält wiederum mehrere Unterschritte.
Von der Recherche über die Planung der Touren bis hin zur finalen Druckfreigabe ist es ein langer Weg zu einem Wanderführer. Der Prozess umfasst fünf sorgfältig koordinierte Schritte, die ich im Folgenden detailliert beschreibe. Die einzelnen Schritte werden jedoch nicht der Reihe nach abgearbeitet, sondern es geht häufig hin und her.
1. Planen
Die Planungsphase ist mit Abstand die aufwendigste – und nie wirklich abgeschlossen.
Am Anfang steht die Recherche nach passenden Wanderungen. Sie müssen ins Format des Buches passen: nicht zu kurz, nicht zu lang, nicht zu anspruchsvoll. Gleichzeitig sollen sie möglichst gut über die ganze Region verteilt sein. Auf der Strecke müssen Highlights liegen, die Tour sollte abwechslungsreich sein und in die Kategorien passen, die der Verlag vorgibt.
Dann kommt die Aufenthaltsplanung. Touren in höheren Lagen sind nur im Sommer machbar – meistens Juli und August. Ich muss also genau überlegen, wann ich wo bin, damit ich mehrere Wanderungen pro Aufenthalt machen kann. Aber: nie mehr als eine pro Tag. Regenphasen sind in den Sommermonaten häufig, deshalb plane ich von vornherein doppelt so viel Zeit ein wie eigentlich nötig.
Selbst wenn ich schon einige Touren fix eingeplant habe, wird später oft umgestellt. Es kommen neue, lohnenswerte Wanderungen dazu, andere fliegen raus.
2. Wandern
Beim Wandern bin ich alleine unterwegs. Das ist eine bewusste Entscheidung. Ich muss mich voll und ganz auf den Weg konzentrieren, Notizen machen und fotografieren. Gespräche oder gemeinsames Wandern lenken mich zu sehr ab – und machen am Ende niemanden glücklich. Deshalb trenne ich berufliches und privates Wandern.
Wie oft ich eine Strecke wandere, werde ich oft gefragt. Die Antwort ist: einmal. Ich zeichne sie mit meiner Sportuhr auf, dokumentiere unterwegs wichtige Punkte mit dem Smartphone und mache die Fotos mit meiner Kamera – in bestmöglicher Qualität.
Ich starte in der Regel früh am Morgen. Nicht nur, weil das Licht besser ist, sondern weil ich dann mehr Ruhe habe. Wenn zu viele Menschen unterwegs sind, kann es passieren, dass ein Gipfelkreuz gar nicht fotografierbar ist – oder dass am Ende fremde Personen auf den Bildern sind.
Ich brauche deutlich länger für eine Tour als andere. Das ist normal, weil ich ständig stehen bleibe, Fotos mache oder Details aufschreibe. Auch gehe ich bestimmte Abschnitte mehrfach und lege damit mehr Kilometer zurück.
3. Schreiben
Direkt nach der Wanderung setze ich mich noch am selben Tag an den Laptop und tippe all meine frischen Erinnerungen in ein Dokument. Das sind meist noch keine fertigen Sätze – eher Stichworte, oft mit Tippfehlern.
Dann mache ich eine Pause. Manchmal schreibe ich noch am selben Abend weiter, manchmal erst ein paar Tage später. Die Aufzeichnung der Route schaue ich mir im Detail an, ob sie dem entspricht, was ich vorab geplant habe.
Parallel bearbeite ich die Fotos: von der Kamera auf die Festplatte übertragen, sichten, aussortieren, in Lightroom bearbeiten, exportieren, benennen. Auch das dauert pro Tour mehrere Stunden.
Jede Tour enthält neben der Beschreibung viele weitere nützliche Infos, wie Distanz, Höhenmeter, Gehzeit, Einkehrmöglichkeiten, Highlights, Anreise und Rückfahrt. Auch diese Infos recherchiere ich noch einmal genau und bereite sie im Text auf.
Beim dritten Durchgang prüfe ich den Text auf Vollständigkeit, Nützlichkeit sowie Grammatik und Rechtschreibung.
Nicht zu vernachlässigen ist auch der vorbereitende Teil für die Steuererklärung. Die Fahrten müssen sauber für das Finanzamt aufbereitet werden. Auch wenn ich damit nicht wirklich was verdiene, müssen Einnahmen versteuert werden. Was in diesem Fall auch die detaillierte Auflistung der Ausgaben beinhaltet.
4. Überarbeiten
Wenn das Manuskript steht – inklusive 20 Touren, Einleitung, Klappentext und ergänzenden Texten – geht es an das Lektorat im Verlag.
Ich bekomme ein Dokument mit Kommentaren und Änderungsvorschlägen zurück. Dieses überarbeite ich gründlich. Recherche, Anpassungen, Fehlerkorrekturen. Mindestens eine Runde ist nötig, manchmal auch mehr.
5. Freigeben
Zum Schluss prüfe ich die Karten, die der Verlag erstellt, und schaue mir das fertige Layout an. Erst wenn ich alles kontrolliert habe, gebe ich die Druckfreigabe.
Bis der Wanderführer dann tatsächlich im Handel erscheint, vergehen noch ein paar weitere Monate.
Mein erstes Buch habe ich während meines Angestelltenverhältnisses geschrieben und meine Arbeitszeit dafür gekürzt. Wie die Schritte zeigen, ist es doch ganz schön aufwendig und erfordert gutes Selbst- und Zeitmanagement. Mir macht die Arbeit sehr viel Spaß, auch wenn man vom Buchschreiben nicht leben kann.
Im nächsten Abschnitt beantworte ich Fragen, die mir beim Schreiben und Erstellen meiner Wanderführer begegnen: Welche Herausforderungen gab es, was kostete der Prozess und mit welchen unvergesslichen Erlebnissen wurde ich belohnt?
Was kostet das Buch schreiben?
In der Regel werde ich gefragt, was man mit einem Buch verdient. Ich beantworte diese Frage lieber aus der Kostenperspektive, denn Wanderführer schreiben ist kein gut bezahlter Job.
Bis auf einen Minianteil an Spesen, den ich vom Verlag erstattet bekomme, trage ich den Großteil der Kosten selbst. Dazu gehören vor allem hohe Fahrtkosten – insbesondere, wenn die Wanderregion nicht gerade vor der Haustür liegt. Hinzu kommen Übernachtungskosten. Wie bereits erwähnt: Ich kann nicht einfach sagen, ich bleibe drei Nächte und mache drei Touren. Wetter und unvorhergesehene Ereignisse machen langfristige Planung schwierig.
In Summe belaufen sich die Ausgaben auf mehrere Tausend Euro. Dazu kommen technische Kosten: Kameraequipment, Lizenzen, Festplatten für die Sicherung der Bilder und Texte.
Im Gegenzug verdiene ich umgerechnet nicht mal einen Euro pro verkauftem Buch. Da kann man kurz schnell mal ausrechnen, wie viele Bücher ich verkaufen muss, um alleine die Ausgaben wieder drin zu haben.
Was während der Buchrecherche schiefging
- Kärnten-Buch: Erst der dritte Versuch gelang (wegen Unwetter- und Straßensperrungen), den Poludnig zu besteigen.
- Kärnten-Buch: Bei einer geplanten Tour habe ich keinen Parkplatz gefunden und musste sie abbrechen.
- Kärnten-Buch: Ich stand im Nebel auf dem Hochobir, einem der schönsten Aussichtsberge in Kärnten – die Tour hat es nicht ins Buch geschafft.
- Kärnten-Buch: Wegen Hochwasser konnte ich meine Recherche im folgenden Jahr erst verspätet fortsetzen.
- Kärnten-Buch: Wanderweg am Zollnersee war nicht zu finden, also bin ich umgedreht.
Erinnerungen für die Ewigkeit
- Steiermark-Buch: Die unverhältnismäßig vielen Notizen, die ich mir während meiner allerersten Recherche gemacht habe.
- Steiermark-Buch: Wie ich bei stürmischem Wetter Richtung Eisenerzer Reichenstein aufgestiegen bin – obwohl ich ans Umkehren gedacht habe – und sich dann die Wolken lichteten und einen unvergesslichen Ausblick freigaben.
- Steiermark-Buch: Wie ich mich nicht getraut habe, die letzten fünf Meter zum Hochlantsch-Gipfelkreuz zu gehen (zwei Jahre später hab ich es geschafft).
- Kärnten-Buch: Eine Nacht habe ich im Dobratsch-Gipfelhaus verbracht und traumhafte Ausblicke zum Sonnenuntergang und Sonnenaufgang erlebt.
- Kärnten-Buch: Wie ich alleine bei wolkigem Himmel auf der Märchenwiese stand und auf die mächtigen Karawanken-Gipfel geblickt habe.
- Kärnten-Buch: Wie ich ab der Klagenfurter Hütte den Kosiak von beiden Seiten versucht habe zu erklimmen – und gescheitert bin.
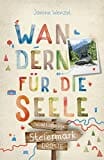
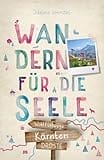





Als jemand, der ebenfalls Reiseführer schreibt, finde ich es immer spannend zu lesen, wie unterschiedlich Autoren an ihre Projekte herangehen.
Ich versuche zum Beispiel häufig, Freunde auf meine Touren mitzunehmen. Der Grund ist allerdings nicht primär, dass mir das mehr Spass macht – was es natürlich tut – sondern es hilft mir auch beim Schreiben. Wieso?
In der Regel habe ich ja schon vor dem Besuch die wichtigsten Fakten zusammen. Die Fragen, die ich dann von meinem Freunden bekomme, bringen mich oft auf Ideen, welchen konkreten Blickwinkel ich beim Schreiben einnehmen möchte oder lassen mich noch das eine oder andere zusätzlich nachschlagen.
Ein anderes spannendes Thema finde ich die Planung. Eine gute Planung ist natürlich sinnvoll, vor allem, wenn man wie bei deinen Projekten nur ein kleines Zeitfenster für die Recherche hat. Aber ich weiss oft erst nach einer eingehenderen Recherche, ob ich ein Thema wirklich aufnehmen will. Und dann habe ich meist schon so viel zusammengetragen, dass ich den Text auch gleich schreiben kann.
Aber ich kann mir vorstellen, dass das auch stark von der Struktur des Buches abhängt. Bei mir sind es im aktuellen Projekt wieder 111 Orte, diesmal über die ganze Schweiz verteilt. Das ist vielleicht auch anderes wie bei dir. Du hast ja in der Regel weniger einzelne Themen, dafür gehen die dann mehr in die Tiefe.
Auf jeden Fall sehr spannend. Danke für den Bericht.
Oli
Lieber Oli,
das ist wirklich ein toller Ansatz, wenn die Freunde noch auf ganz andere Dinge aufmerksam machen.
Bisher hatte ich 1,5 Jahre pro Projekt, wobei die langen Winter und kargen Monate rausfallen. Beim jetzigen Projekt habe ich mir zwei Monate blockiert.
Bin auf dein nächstes Buch gespannt.
LG, Janine
Danke für deine ehrlichen Einblicke! Natürlich ganz anders, einen Wanderführer zu erstellen, als Computerbücher wie in meinem Fall. Und wie du schreibst: die Liebe zum eigenen Produkt muss da sein, denn reich wird man nicht. 🙂
Viele Grüße
Christian
Liebe Janine,
ich fand es sehr spannend, einmal zu lesen, wie so ein Buchprojekt für dich als Autorin entsteht. Was du in deinem Beitrag allerdings offengelassen hast, hat bei mir gleich eine ganze Reihe von Fragen aufgeworfen:
Wie kam der Kontakt zum Verlag zustande – hast du ihn gefunden oder hat er dich angesprochen?
Bringst du eigene Ideen und Regionen ins Spiel oder gibt der Verlag das Thema vor?
Wie sieht es mit dem zeitlichen Rahmen aus – musst du unter Druck arbeiten?
Wird die Auflage bereits zu Beginn festgelegt? Und wie aktiv ist der Verlag bei der Vermarktung?
Da sich der Aufwand finanziell offenbar kaum lohnt: Welche Synergieeffekte ergeben sich für dich aus diesen Projekten?
Dein Beitrag hat auf jeden Fall meine Neugier geweckt.
Liebe Grüsse
Susan
Liebe Susan,
ich hab hier bewusst nur den Teil des Schreibens bzw. Recherchierend vorgestellt. Die andern Themen wären aber sicher einen eigenen Artikel wert.
LG, Janine